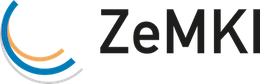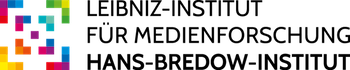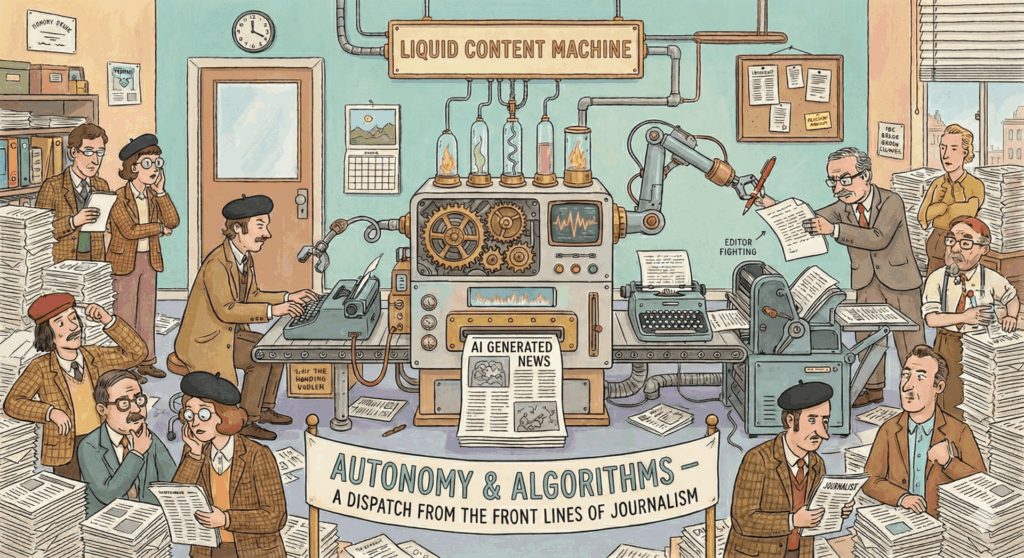
Wie beeinflusst die Aneignung von kommunikativer KI im Journalismus die Konzeption von journalistischer Autonomie?
Promotions-Projekt von Jonah Wermter
Autonomie ist ein Kernkonzept des Journalismus. Es wird sogar als legitimierendes Element genannt, das den Journalismus von benachbarten Domänen wie PR oder Werbung unterscheidet (Lauerer et al., 2025; Örnebring & Karlsson, 2022; Sjøvaag, 2013). Allerdings handelt es sich auch um ein viel diskutiertes Konzept. Während das Ideal einer vollkommenen Unabhängigkeit von externen Einflüssen auf die journalistische Arbeit für die professionelle Selbstkonzeption nach wie vor zentral ist, ist die Unvermeidbarkeit eben dieser Einflüsse in der wissenschaftlichen Literatur unbestritten (Lauerer et al., 2025). Dazu zählen beispielsweise die Beziehung zum Publikum oder die Abhängigkeit von Quellen oder – auf einer institutionellen Ebene – von den Logiken des ökonomischen und politischen Systems. Daher scheint es sinnvoll, journalistische Autonomie nicht negativ über die Unabhängigkeit zu definieren, sondern positiv über die Fähigkeit eigenständig festzulegen, was als journalistisch angesehen wird und was nicht[1]. Auf individueller Ebene bietet sich eine Konzeptionalisierung über die redaktionelle Freiheit an, z.B. die Entscheidungsfreiheit, über welche Geschichten geschrieben wird.
Meine Dissertation folgt der Hypothese, dass das Aufkommen und die Aneignung kommunikativer KI (Esposito, 2024) im Journalismus die journalistische Autonomie auf verschiedenen Ebenen beeinflussen wird, da Sie sowohl das Informationssystem um den Journalismus als auch die Arbeitsweisen im Journalismus grundlegend verändert: KI-Systeme spielen eine wachsende Rolle als Informationsintermediäre, die etablierte journalistische Formate (zusammenhängend, starr wie Artikel oder Reportagen) zu Gunsten von liquidem Content (modular, personalisierbar, interaktiv) verändern. Journalist:innen könnten in der Folge Informationen für Maschinen produzieren statt Narrative für Menschen. Außerdem birgt KI das Potential, den ohnehin bestehenden ökonomischen Druck auf Organisationen sowie individuelle Journalist:innen zu erhöhen, bspw. durch einen erhöhten Effizienzdruck sowie strukturelle Änderungen im Werbemarkt.
Zusammengenommen werden diese Entwicklungen dafür sorgen, dass sich die Bedeutung von „journalistisch“ in der Domäne verändert – was wiederum die oben genannte Fähigkeit zur Selbstbestimmung tangiert, da die Entwicklungen nicht aus der Domäne selbst angeschoben wurden. In Vorstudien ließ sich bereits beobachten, dass unter Journalist:innen und Pionier:innen ein Diskurs über den „Kern des Journalismus“, sprich dessen konstituierende Praktiken und Merkmale, geführt wird. Seit Maschinen gelernt haben, wie Menschen zu kommunizieren (Esposito, 2024) und qualitativ hochwertige Texte zu produzieren, scheint sich der professionelle Fokus von Journalistinnen weg von der Text- bzw. Inhaltsproduktion als Schlüsselkompetenzen zu verschieben, und hin zum Urteilsvermögen, dem Aufbau von menschlichen Beziehungen sowie dem Erhalt von Vertrauenswürdigkeit. Somit führt die Aneignung von Kommunikation und Sprache durch KI zu einer selbstbehauptenden Neubestimmung des Journalismus – eine Praxis, die als boundary work (Carlson & Lewis, 2015) beschrieben werden kann.
Indem ich verschiedene hybride Figurationen (Hepp et al., 2018; Hepp & Hasebrink, 2017) der Aneignung von ComAI im Journalismus analysiere, werde ich die Neukonzeption von journalistischer Autonomie in Bezug auf individuelle sowie institutionelle Frameworks untersuchen (Breaugh, 1985; Carlson & Lewis, 2015; Haim & Kunert, 2025; Lauerer et al., 2025; Örnebring & Karlsson, 2022). Ethnographische Studien in Redaktionen sowie Gruppendiskussionen mit Journalist:innen aus der Breite des Berufsfelds werden mir ein tiefgreifendes Verständnis der Veränderungen im Arbeitsalltag und des beruflichen Selbstverständnis durch kommunikative KI ermöglichen. Konferenzethnografien sowie semi-strukturierte Interviews mit journalistischen Pionier:innen (Hepp & Loosen, 2021) und Entscheidungsträger:innen komplementieren die Analyse auf institutioneller Ebene. Zudem plane ich anhand von Daten aus dem Research Space zu untersuchen, wie sich die Aneignung von KI auf die Sprache und den Stil des Journalismus auswirkt und damit die kreative und episodische Autonomie von Journalisten beeinflusst. Zusammengenommen wird dieser multimethodische Ansatz wichtige Erklärungen für die Positionierung des Journalismus in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft liefern.
[1] Dies ist nicht im Sinne von Professionalität zu verstehen, d. h. der Fähigkeit der Institution, den eigenen Zugang zu kontrollieren und zertifizieren. Vielmehr geht es um die Fähigkeit der Institution, einen selbstbestimmten Diskurs über das eigene Selbstverständnis zu führen sowie ihre gesellschaftliche Wahrnehmung zu bestimmen.
Literatur
Breaugh, J. A. (1985). The Measurement of Work Autonomy. Human Relations, 38(6), 551–570. https://doi.org/10.1177/001872678503800604
Carlson, M., & Lewis, S. C. (2015). Boundaries of journalism: Professionalism, practices and participation. Routledge, Taylor & Francis Group.
Esposito, E. (2024). Kommunikation mit unverständlichen Maschinen. Residenz Verlag.
Haim, M., & Kunert, J. (2025). XII. Technologische Innovation im Journalismus. In T. Hanitzsch, W.
Loosen, & A. Sehl (Hrsg.), Journalismusforschung (S. 249–264). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. https://doi.org/10.5771/9783748932291-249
Hepp, A., Breiter, A., & Hasebrink, U. (Hrsg.). (2018). Communicative Figurations: Transforming Communications in Times of Deep Mediatization. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65584-0
Hepp, A., & Hasebrink, U. (2017). Kommunikative Figurationen. Ein konzeptioneller Rahmen zur Erforschung kommunikativer Konstruktionsprozesse in Zeiten tiefgreifender Mediatisierung. Medien & Kommunikationswissenschaft, 65(2), 330–347. https://doi.org/10.5771/1615-634X-2017-2-330
Hepp, A., & Loosen, W. (2021). Pioneer journalism: Conceptualizing the role of pioneer journalists and pioneer communities in the organizational re-figuration of journalism. Journalism, 22(3), 577–595. https://doi.org/10.1177/1464884919829277
Lauerer, C., Altmeppen, K.-D., & Riedl, A. A. (2025). Autonomie und Einflüsse im Journalismus. In T. Hanitzsch, W. Loosen, & A. Sehl (Hrsg.), Journalismusforschung (1. Auflage). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. https://doi.org/10.5771/9783748932291
Örnebring, H., & Karlsson, M. (2022). Journalistic Autonomy: The genealogy of a concept. Univ. of Missouri Press.
Sjøvaag, H. (2013). Journalistic Autonomy: Between Structure, Agency and Institution. Nordicom Review, 34(s1), 155–166. https://doi.org/10.2478/nor-2013-0111
Kontakt
Fragen beantwortet:
Prof. Dr. Andreas Hepp
ZeMKI, Zentrum für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung
Universität Bremen
Tel: +49 421 218-67620
Assistenz Frau Schober: +49 421 218-67603
E-Mail: andreas.hepp@uni-bremen.de