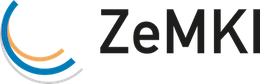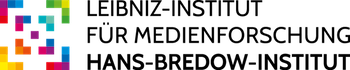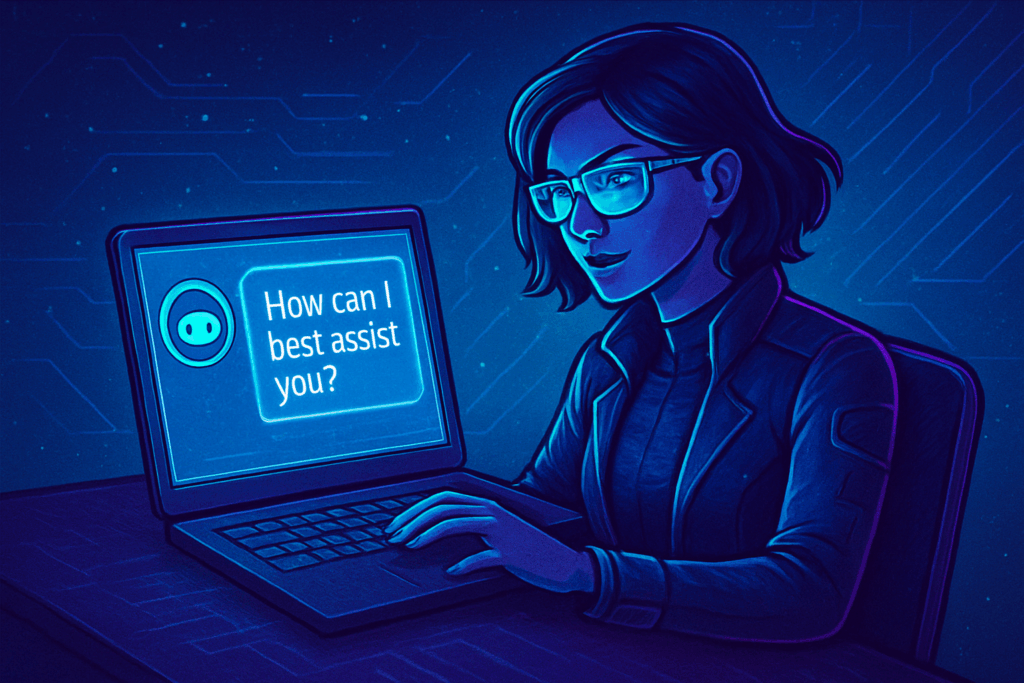
Gestalten oder anpassen? Empfundene und zugeschriebene Agency bei der Aneignung von kommunikativer KI im Journalismus
Promotions-Projekt von Antonia Eichenauer
Neuen Technologien, die als Schlüsseltechnologien eingestuft werden – wie KI –, wird häufig eine gewisse Agency zugeschrieben. Agency kann hier zunächst als Handlungsfähigkeit verstanden werden, der eine gewisse Wirkungsmacht innewohnt. Solche Handlungsfähigkeit zeigt sich, wenn KI als Treiber eines Medienwandels gesehen wird, der das gesamte Informationssystem umkrempelt. Insbesondere im professionellen Kontext kommt Menschen in solchen Momenten vor allem die Aufgabe, die neue Technology schnell aufzugreifen (Brown et al. 2016).
Für meine Doktorarbeit frage ich, wie sich das im Journalismus zeigt. Wie nehmen Journalist:innen kommunikative KI wahr? Und wie steht es um ihre eigene Handlungsfähigkeit und Handlungsmacht, wenn es darum geht, in einer Welt mit KI Journalismus zu machen? Mit der Positioning Theorie von Harré und Kollegen (Harré & van Langehove 1999) lässt sich untersuchen, wie das Verhältnis zwischen Journalismus und kommunikativer KI verhandelt wird. Die Theorie ermöglicht es auf der Mikro-, Meso- und Makroebene zu analysieren, wie sich Journalist:innen, journalistische und Verlage gegenüber KI-Unternehmen oder der Technologie als solche positionieren.
Solche Positionierungen zeigen sich in der Kommunikation mit einem Gegenüber, in diesem Fall in Interaktionen von Journalist:innen mit kommunikativer KI, aber auch in den Geschichten, die über das Gegenüber erzählt werden, zum Beispiel wie Journalist:innen in Interviews oder Gruppendiskussionen über KI sprechen oder was Verlage im Diskurs um KI für sich beanspruchen. Erste Ergebnisse zeigen, dass Journalist:innen kommunikative KI vor allem als hilfreiches Werkzeug verstehen, das sie für ihre Arbeit nutzen. Gleichzeitig bestehen aber auch Sorgen davor, von KI ersetzt zu werden. Verlage betonen journalistische Werte wie Faktizität und Sorgfalt und positionieren sich als vertrauenswürdige Nachrichtenquelle in Abgrenzung zu einer halluzinierenden Maschine.
Als Datengrundlage dient mir für die Dissertation unsere ethnografische Feldforschung aus P5. Auch unsere Expert:inneninterviews mit Pionier:innen, Gruppendiskussionen mit festangestellten und freien Journalist:innen und den metajournalistischen Diskurs werde ich in meine Analysen einbeziehen. Dabei fokussiere ich insbesondere darauf, wie die Zukunft des Journalismus vorgestellt und gestaltet wird. Das Datenmaterial werde ich inhaltlich, aber auch sprachkritisch untersuchen. Dabei wende ich eine Metaphernanalyse an, um auch die hinter den Aussagen liegenden Denkmuster explizieren zu können.
Aus den Analysen wird sich zeigen, wie viel Gestaltungsspielraum Journalist:innen empfinden, wenn es darum geht, ihre Arbeit und die Zukunft ihrer Profession mit kommunikativer KI zu gestalten.
Kontakt
Fragen beantwortet:
Prof. Dr. Andreas Hepp
ZeMKI, Zentrum für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung
Universität Bremen
Tel: +49 421 218-67620
Assistenz Frau Schober: +49 421 218-67603
E-Mail: andreas.hepp@uni-bremen.de